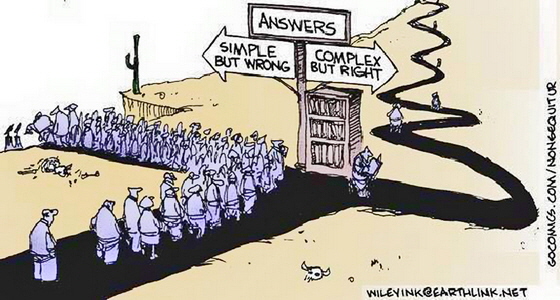|
|
||||||||||||||||||||||
|
DIE ZWEITE GRUNDGEGEBENHEIT
03.03.22 DAS BEWUSSTSEIN BESTIMMT DAS GESELLSCHAFTLICHE SEIN
Einleitung zum Thema ‚prä-argumentatives Denken‘ Es ist ein scheinbar ohne Weiteres plausibler Satz der Erkenntnistheorie: „Bewußtsein ist immer nur Bewußtsein von Gegenständlichem, insofern es nämlich Denken ist; Denken ist immer ein Denken von etwas, und umgekehrt ist Gegenständliches uns gegeben immer nur durch unser Bewußtsein hindurch, also als ein durch unsere Bewußtseinsakte Gemeintes und Konstituiertes.“ (S. 151) [Theodor W. Adorno: Vorlesung zur Einleitung in die Erkenntnistheorie, Junius-Drucke, Ffm, o.J., vermutlich ca. 1969. Vorlesung gehalten 1957/58, Uni Frankfurt. Offenbar handelt es sich um eine Mitschrift einer Tonband-Aufzeichnung von Hörern dieser Vorlesung]. Normalerweise erscheint einem dieses (gegenständliche) ‚Denken‘ völlig unhinterfragt als gegeben. Es ergibt sich aus irgendeiner Anregung und ist dann einfach da. Woher es kommt, und warum es da ist, wird höchstens – wenn überhaupt danach gefragt wird – üblicherweise nur oberflächlich beantwortet. Man denkt z.B. man sei „ganz eigen“, habe ganz eigene politische Vorstellungen, ganz eigene Vorstellungen von Kleidung und Frisur, ganz eigene Vorstellungen von toller Musik, ganz eigene Vorstellungen darüber, wer gerade der internationale Schurke ist, und merkt gar nicht, wie sehr diese ‚Eigenheit‘ mehr oder minder gesellschaftlich determiniert ist. Denn bei der genaueren Frage, was denn nun solches „Denken“ in seiner eigenen Wirklichkeit ist, kommt die obige erkenntnistheoretische Plausibilität an ihre Grenzen. Es tauchen gewisse Komplikationen auf. So gibt es etwa sprachliche Dispositionen. z.B. eine Wirklichkeit des Denkens ist die Anwendung der Sprache. Es ist klar, dass ohne ausreichend differenzierendes Vokabular ein „Denken von etwas“, kulturell-historisch betrachtet, ziemlich eingeschränkt sein kann. Eine wissenschaftlich differenzierende Sichtweise auf „Gegenständliches“ setzt eine entsprechend historisch entwickelte wissenschaftliche Fachsprache voraus. Des Weiteren gibt es soziale Dispositionen, was man über irgendwelche Phänomene zu denken hat. Ein Nazi sieht eine Jüdin ‚mit anderen Augen‘ an als ein Kind, das in einem Kindergarten eine freundliche und liebevolle Betreuerin erleben darf (die nebenbei auch jüdisch-gläubige Vorfahren hat). Sodann gibt es psychische Dispositionen des Denkens: Manche Leute sind für ‚2-Minuten Hass-Sendungen‘ (gemäß Orwell) empfänglicher als andere und werden viel intensiver zum fanatischen Hasser des ‚Feindes‘ – müssen diesen dämonisieren und sie sehen dabei ihre Art des dämonisierenden Denkens als durchaus ‚gegenständlich‘ adäquat an. Dämonisierendes Denken kann man sehr gut in YouTube-Kommentaren bzgl. kontroversen politischen Themen feststellen. Solcherlei ‚Disposition‘ des gegenständlichen Denkens – und zwar in sehr grundlegender Weise - stellt auch die Argumentations-Unfähigkeit (siehe dazu auch „Projekt Argumentation“) des prä-argumentativen Denkens dar, das ich hier genauer analysieren möchte.
Adorno erzählt in seiner Vorlesung (S.158 f.) die folgende Anekdote über den <Präsident Kulisch, der sehr wortkarg war. Der ging eines Sonntags in die Kirche, und seine Frau hat ihn bei der Heimkehr gefragt: Worüber hat der Pfarrer gepredigt? Da hat er gesagt: Über Sünde. – Nun, was hat er denn gesagt? Er war dagegen.> - Nach dieser Anekdote holt Adorno zu folgendem interessanten Kommentar aus: <Genau diese Art des Dafür – oder Dagegenseins, diese Absehbarkeit in allen geistigen Dingen, scheint mir allerdings eines der verhängnisvollsten Symptome der Verdummung und Verhärtung der Welt zu sein, (…)> Damit hat Adorno meiner Ansicht nach in der Tat ein wahres Wort gelassen ausgesprochen! Denn genau diese Haltung der Absehbarkeit in allen geistigen Dingen findet man überall, wo es primär auf eine Gesinnung ankommt und Argumente bestenfalls dazu dienen sollen, diese Gesinnung zu stützen. Das ist dermaßen tief eingefleischt, dass viele genau das unter Diskussion, Debatte oder sogar als ‚Argumentation‘ verstehen. Tatsächlich könnte man dies als DIE erste GRUNDGEGEBENHEIT des prä-argumentativen Denkens ansehen: Gesinnungsmäßige Werturteile sind das Non-Plus-Ultra des prä-argumentativen Denkens.
Ich habe jetzt eine ERSTE GRUNDGEGEBENHEIT des ‚Prä-argumentativen Denkens‘ behandelt. Wie komme ich dazu? Und gibt es noch mehr solcher GRUNDGEGEBENHEITEN? Wie komme ich dazu? Durch die Arbeit über die „Ideologische Argumentationen“ kam ich zur Erkenntnis (schließlich mit Hilfe von Karl Popper), dass offenbar eine ziemlich junge Sprachentwicklung (seit ca. 2500 Jahren – ab der Entfaltung der beweishaften Geometrie in Griechenland) vom prä-argumentativen Denken hin zum argumentativen Denken existiert. Diesem argumentativen Denken haben wir die Wissenschaft zu verdanken. Mir war auch mittlerweile schon klar geworden, dass argumentatives Denken keineswegs ein selbstverständliches Können aller Menschen ist, sondern dass dies eine kulturelle Errungenschaft ist, analog zur Beherrschung der Schrift. Nun war meine wissenschaftliche Arbeit eigentlich genau darauf ausgerichtet, die Differenz zwischen argumentativ haltbarem und speziell interessegeleitetem unhaltbarem ‚ideologischem‘ Denken an etlichen Phänomenen mit entsprechenden konkreten Beispielen empirisch auszumachen. Tatsächlich habe ich damit die prä-argumentative Sprache (ohne dies vorher explizit zu wissen) beispielhaft unter die Lupe genommen – und zwar beschränkt auf den brisanten Bereich interessegeleiteter, manipulativer Sprachverwendung.
gibt es noch mehr solcher GRUNDGEGEBENHEITEN? Ich werde folgendermaßen vorgehen, um diese Frage zu behandeln: Meine geschilderten Muster und die entsprechenden Beispiele in meiner Arbeit werde ich als Vorlage nehmen, um zu erkennen, wo hier Prinzipien (GRUNDGEGEBENHEITEN) der prä-argumentativen Sprachverwendung auszumachen sind.
In No.39 der „Ideologischen Argumentationen“ wird die Primärprozess-Argumentation abgehandelt. Was ist darunter zu verstehen? Die Wikipedia schreibt einleitend: <Mit Primärprozess werden in mancher psychoanalytischen Literatur alle Vorgänge des unbewussten Seelenlebens bezeichnet, die nach dem Lustprinzip ablaufen. Freud, der den Begriff im letzten Kapitel der Traumdeutung der Sache nach eingeführt hat, spricht in seinem Werk durchgängig von Primärvorgang.> Weiter unten heißt es: <Der Primärprozess ist kennzeichnend für die individuelle menschliche Ontogenese als früheste kindliche Entwicklungsphase.> Interessant für mein Thema ist noch der folgende Satz: <Es kann als Beitrag der Psychoanalyse zur Sprachforschung angesehen werden, dass die scharf umrissene Bedeutung eines Worts sich zuletzt ausformt, d. h. psychoanalytisch ausgedrückt, ein spätes Resultat des Sekundärprozesses ist.> Was man im Erwachsenen-Leben als Primärprozess-Denken bezeichnen kann, wurde von Bateson folgendermaßen formuliert: <Es ist ein Charakteristikum unbewußten oder „Primärprozeß“-Denkens, daß der Denkende unfähig ist, zwischen „einige“ und „alle“ oder zwischen „nicht alle“ und „keine“ zu unterscheiden. Es scheint, als würden diese Unterscheidungen nur in höheren und bewußteren geistigen Prozessen erreicht, die beim nicht psychotischen Individuum dazu dienen, das Schwarz-Weiß-Denken der unteren Ebenen zu berichtigen.> [Aus: Gregory Bateson: Ökologie des Geistes (Ffm 1985, stw 571). Darin der Aufsatz (S.241-261): „Eine Theorie des Spiels und der Phantasie (1954)“. DIE Zitat ist Seite 250]. Man sieht also, dass nach Bateson dieses ‚Primärprozess-Denken‘ wesenhaft durch Übertreibung gekennzeichnet ist. Aber ich denke, seine zwei Beispiele erschöpfen nicht alles, was da eigentlich mit dazu gehört. Außerdem gehört dazu etwa noch die polarisierende Argumentation von No.18 (Abwehrmechanismen), die ja, bei genauerer Betrachtung, ebenfalls eine Abart von Übertreibung ist.
Da eine prä-argumentativ disponierte Persönlichkeit keine Bemühung aufwenden kann, einen Sachverhalt begrifflich klar zu sortieren und sodann als Hypothese argumentativ zu offerieren, um sie damit der (argumentativen) Kritik auszusetzen (‚Realitätsprinzip‘), steht solch einer Persönlichkeit als Ausdruck ihrer Meinung lediglich die emotionale Wertentscheidung, die dem ‚Lustprinzip‘ entstammt, zur Verfügung. Nur dieser emotionalen Wertentscheidung kann sie die Sprache (samt Stimme, Gestik und Mimik z.B. von Empörung, Betroffenheit, Moralismus, Besserwissen) verleihen, um ihre Meinung zu artikulieren. Was besagt dieses ‚Lustprinzip‘ im Zusammenhang von Denken? Zunächst bedeutet es individuelle Willkür: „Weil es mir so gefällt!“. Zu dieser Willkür passt auch eine gewisse Gier: Ich kann nicht genug davon bekommen! – In der Sprache der Meinung drückt sich das als Übertreibung bis hin zur Lüge und Beleidigung aus: Aussagen wie „das ist ja wohl der Gipfel“, „unerhört“, „unglaublich“, „so ein Spinner“ gehören noch zur untersten Stufe der Übertreibungsskala der Lüge und des Beleidigens. Sodann bedeutet die Anwendung des Lustprinzips Anlehnung an ein „Man“. Der Grund liegt darin, dass jeder Mensch nach gesellschaftlicher Anerkennung strebt und wenn jemand mit mangelnder Fähigkeit zur Argumentation und damit Unfähigkeit zu haltbarer Reflexion geistig-kulturell nur unzureichend gebildet ist, so ist er/sie vorwiegend auf die nackte konventionelle Intersubjektivität, oder kurz: die gesellschaftliche Konvention, als Orientierung angewiesen: Man darf das nicht, Man tut das nicht, man sagt das nicht, sowas darf man nicht mal denken, das geht nicht, das kann man doch nicht tun. All diese „man sollte, man muss, man darf nicht“ könnte man mit Hilfe von Reflexion jeweils einzeln hinterfragen und dadurch zu einer eigenständigen Persönlichkeit gelangen, für welche nicht unbedingt nur die Konvention – soweit sie haltbar ist - sondern eben auch andere Sachverhalte wie z.B. empirische Haltbarkeit (‚Belege‘), Begründung und Widerspruchsfreiheit der Aussagen, Freiheit des Denkens und der rationalen Kritik zu einer haltbaren geistigen Orientierung gehören. <Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kragen ist auch werktags rein, und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich ihm: ”Nein!” Da behält man seinen Kopf oben, und man bleibt ganz allgemein.> (…) <Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen, ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen, ach, da gibt’s überhaupt nur: Nein!>
(Barbara-Song in der Dreigroschenoper. Gesungen von Lotte Lenya 1930: gibt es bei YouTube).
DIE ZWEITE GRUNDGEGEBENHEIT des prä-argumentativen Denkens lautet also: Es handelt sich um emotionales, am Lustprinzip orientiertes Denken mit den Komponenten der Übertreibung, der Willkür und der Orientierung an der Intersubjektivität des ‚Man‘, die auf gesellschaftlicher Konvention beruht.
Ableitungen aus dieser GRUNDGEGEBENHEIT: Wenn ein Argumentationsunfähiger (=Auf) an die Macht kommt, ist damit zu rechnen, dass diese Macht mehr oder minder in Willkür ausartet – je nachdem wie weit diese Macht kontrolliert werden kann, etwa durch ‚checks and balances‘.
Ein Auf (= ein Argumentationsunfähiger) ist logischerweise immun gegenüber argumentativ vorgetragener Kritik, weil er dafür im wahrsten Sinne des Wortes kein Verständnis hat. Er kann darin lediglich (emotionale) Feindseligkeit erkennen, weil dies seine ihm (und seinesgleichen) einzig zur Verfügung stehende eigene Form von Kritik ist. Entsprechend emotional wird er auf die argumentative Kritik reagieren. Folglich ist ein Auf kritikimmun – es sei denn jemand kritisiert ihn ebenfalls auf emotionale Weise. Jedoch gegenüber argumentativer Kritik im eigentlichen Sinne verhält er sich starr und uneinsichtig – also dogmatisch. Somit ist er bestenfalls nur durch Druck: also Drohung, Liebesentzug, Gewalt oder Schadenserleidung – in (lediglich engen) Grenzen – lernfähig. Hans Albert versteht unter ‚Kritikimmunität‘ „ – im Anschluss an Karl Popper – alle Versuche, Theorien, religiöse oder säkulare Anschauungen durch Dogmatisierung gegen unvoreingenommene, kritische Überprüfung, d.h. gegen rationale Einwände abzuschirmen (zu immunisieren), unwiderlegbar zu machen, indem man sie z. B. zu absoluten und unumstößlichen Wahrheiten erklärt.“ (philoclopedia: Kritikimmunisierung). DIE DRITTE GRUNDGEGEBENHEIT des prä-argumentativen Denkens lautet: Es handelt sich um starres, dogmatisches Denken, das rationale Kritik lediglich als Feindseligkeit interpretieren kann und selber Kritik nur in emotional-irrationaler Form vortragen kann.
Folgerungen:
behandelt die tendenziell moralische Defizienz des prä-argumentativen Denkens. Das Denksystem eines Auf (= eines Argumentationsunfähigen) ist per Definition nicht an Rationalität orientiert und ist deswegen durchaus auch offen für logische Widersprüchlichkeit. Somit können nebeneinander zwei Seelen in seiner Brust koexistieren: eine gutmeinende und eine lieblose, einseitig interessegeleitete, die sich über die andere Person und ihr Wohlergehen und Vertrauen hinwegsetzt. Dass hier etwas nicht stimmt, wird nach Innen per Abwehr verdrängt und nach Außen möglichst verheimlicht. Ein Liebhaber beispielsweise, der seine Frau tatsächlich zu lieben glaubt, kann dennoch das Bedürfnis haben, fremd zu gehen, was (üblicherweise) der Frau wehtun würde, wenn ihr Ur-Vertrauen dadurch gestört würde. Sie könnte sich deshalb in ihrer Gekränktheit von ihm mehr oder minder abwenden, deshalb verheimlicht er es vor ihr. DIE VIERTE GRUNDGEGEBENHEIT des prä-argumentativen Denkens lautet: Aufgrund seiner mangelnden Rationalität ist das prä-argumentative Denken offen für logische Widersprüchlichkeit zwischen Gutheit (Fürsorge, Mitleid, Menschlichkeit, Empathie, Ehrlichkeit) und Amoralität (Kaltherzigkeit, Lieblosigkeit, Achtungslosigkeit, Unredlichkeit, Mitleidlosigkeit, Erbarmungslosigkeit, Skrupellosigkeit), wobei sich jene Amoralität bei entsprechenden einseitigen Interessenlagen ergibt.
Folgerungen:
Prä-argumentatives Denken hat Schwierigkeiten mit allen drei Zeitformen. Die Vergangenheit wird zurechtgebogen durch Auslassungen, Verdrängungen und willkürlichen Interpretationen. Beispielsweise die wesentliche Mitschuld an dem Ausbruch des 1. Weltkriegs durch Deutschland wird kurzerhand dadurch erledigt, dass (ohne jeden Beweis) die Juden die eigentlichen Kriegstreiber gewesen seien (vgl. haltlose Hitler-Argumentationen (4)) Und der Sieg, der eigentlich den Mittelmächten (Deutschland und Österreich-Ungarn) zustand, wurde durch die deutsche Revolution 1918 dolchstoßmäßig heimtückisch vereitelt. ‚In Wahrheit‘ (also ohne die Arbeiter- und Soldatenrevolution) war angeblich das deutsche Heer in Frankreich „im Felde unbesiegt“. Die Gegenwart wird inadäquat beurteilt, indem vielerorts das archaische Paradigma vom Boten schlechter Nachrichten (vgl. No.01) Geltung hat: Die Nachricht mögen wir nicht, sie ist ein Affront wider unsere Gesinnung (vgl. ERSTE GRUNDGEGEBENHEIT) und das liegt an dem verdammten Boten, der dafür bestraft werden muss. (Siehe z.B. No.11 - Bewerkstelligen eines falschen, unwahren Konsenses, Beispiel 3: Ausgrenzung der Partei AfD).
Mögliche Zukünfte werden erst gar nicht ausgespäht, weil das prä-argumentative Denken nur von hier bis da denkt und unfähig ist, die Folgen mit zu bedenken. Denn dazu wäre ernsthaftes argumentatives und eigenständiges Denken und entsprechende Suche nach solider Information nötig. So also rennen Menschenmassen in Deutschland beispielsweise 1914 kriegsbegeistert in das Unheil und Kaiser Wilhelm II. kennt keine Parteien mehr (also vor allem keine Sozialdemokraten), sondern nur noch Deutsche. Und genauso dumpfbackenmäßig verabscheuten deutsche Arbeiter-und Soldaten-Massen 1944 die ‚Verbrecher‘ des 20. Juli. (Siehe dazu: No.48 - Mangelnde Fallunterscheidung als wesentliches Element von Propaganda, 1. Beispiel). Und in eben dieser Tradition wollen 51% der Deutschen im April 2022 Waffenlieferungen in die Ukraine – selbstverständlich ohne die möglichen oder sogar wahrscheinlichen gefährlichen Folgen für Deutschland zu bedenken: <Einer Umfrage zufolge hat sich eine knappe Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv befürworten 51 Prozent die Lieferung von Offensivwaffen und schwerem Gerät – 37 Prozent sind dagegen.> (Quelle: Zeit.de, 19.04.22).
Somit lautet DIE FÜNFTE GRUNDGEGEBENHEIT: Prä-argumentatives Denken kann weder Vergangenheit noch Gegenwart noch mögliche Zukünfte objektiv beurteilen. Dazu fehlt die argumentative Kompetenz. Die Vergangenheit wird zurechtgebogen, wie man sie braucht. Für die Gegenwart werden Boten schlechter Nachrichten (also z.B. Kritiker irgendwelcher offiziellen Linien) abserviert. Mögliche problematische Zukünfte als Folgen gegenwärtiger Handlungen können nicht argumentativ anspruchsvoll ins Visier genommen werden.
|